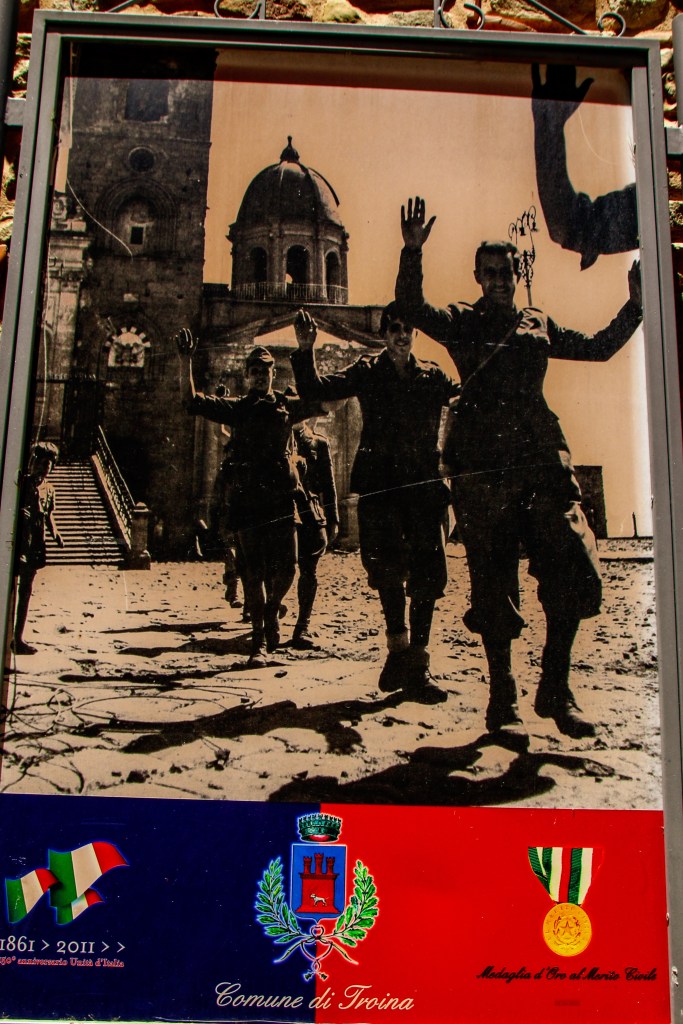6 Uhr. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Noch schieben sich ein paar Wolken, die von der Nacht übrig geblieben sind, vor sie. Aber nicht lange, sie lösen sich schnell auf. Ich sitze auf der Dachterrasse. Auch in der Nachbarschaft gehen die Jalousien hoch. In Sizilien steht man früh auf und bleibt lange wach. Es wird heiß heute. Deshalb noch mal in aller Ruhe durchatmen und Kaffee trinken.

8 Uhr. Ich muss zum Bäcker, samstags ist dort schnell alles ausverkauft. Die Sonne brennt direkt in die Straße, es gibt zu dieser Tageszeit kaum Schatten in der Via Tamagnino. Schnell läuft mir der Schweiß ins Gesicht. Vor „Il Forno“ hat sich bereits eine Schlange gebildet. Das warten im klimatisierten Verkaufsraum geht in diesen Zeiten nicht. Mit Mundschutz stehe ich mit den anderen Kunden in der prallen Sonne. Wenigstens fängt die Mund-Nasen-Bedeckung auch den Schweiß auf. Trotz der frühen Uhrzeit ist die Auswahl bereits eingeschränkt. Dann will ich auch noch zum Metzger, der auch einen kleinen Lebensmittelmarkt integriert hat, Wasser kaufen. Aber davor ist die Schlange noch länger, auch wenn ich hier im Schatten warten könnte. Ich verschiebe das.
9 Uhr. Eiskalt zu duschen habe ich mir abgewöhnt, man schwitzt hinterher noch mehr. Das gleiche, wenn man Wasser aus dem Kühlschrank trinkt. Am besten, es ist körperwarm, das zu taxieren ist bei diesen Temperaturen kein Problem, wenn man es einfach auf dem Küchentisch stehen lässt. Um Wasser zu sparen, ich habe im Augenblick nur noch eine angebrochene 1,5-Liter-Flasche, mache ich mir nochmal einen Kaffee und frühstücke.
10 Uhr. Die Waschmaschine ist durch, ich hänge die nassen Teile auf die Leine. Als das letzte Stück fixiert ist, ist das erste bereits wieder trocken. Unterdessen hat jemand im Himmel den Heißluftfön angemacht. Also Fenster und Läden schließen, sonst ist es später im Haus wie im Backofen.
11 Uhr. Ich mache erstmal eine Pause. Nur nicht an die Hitze denken. Letzte Woche hatte ich noch gedacht, dass dieser Juli eine herbstliche Anmutung habe. Es gab tagelang Gewitter, es hat viel geregnet, in Palermo und bei Catania gab es sogar üble Überschwemmungen. Dazu lagen die Temperaturen „nur“ bei 30 Grad. Die Strände waren leer und man hatte sich im Sand nicht die Füße versengt. Mit sowas rechnet hier im Juli keiner. In den Zeitungen hatten sie geschrieben, dass das der Klimawandel sei und dass der Mittelmeerraum davon stärker als andere Regionen betroffen sei. Das glaube ich auch, denn das, was ich in den vergangenen Jahren hier bereits an Wetterphänomenen erlebt habe, ist beängstigend.
12 Uhr. Irgendwer röstet im Vico auf dem Holzkohlegrill Paprika. Das riecht lecker, aber allein die Vorstellung, jetzt vor glühenden Kohlen zu stehen, verursacht mir einen Schweißausbruch.
13 Uhr. Ich hole beim Metzger Wassernachschub. Esse was vom gestern übrig gebliebenen Abendessen. Kein Kaffee. Vielleicht doch an den Strand, obwohl ich kaum Hoffnung habe, dass dort Platz ist. Die Abwägung, ob ich es wagen soll oder nicht, dauert eine halbe Stunde. Weil ich auf den Kaffee verzichtet habe, werde ich müde. Nur mal kurz die Augen zumachen…
16 Uhr. Die Sonne scheint jetzt durch die Ritzen der Fensterläden. Im Zimmer ist es unerträglich heiß. Meine Wetter-App sagt 36 Grad im Schatten. Der italienische Wetterdienst warnt vor der extrem hohen Temperatur. Draußen ist es totenstill, bloß nicht bewegen. Es geht hier auf der Insel aber noch heißer: Temperaturen knapp unter 48 oder – je nach Quelle – sogar fast 49 Grad wurden in Sizilien schon gemessen. Nur im Death Valley/USA zeigte das Quecksilber einen noch höheren Wert an: über 56 Grad. Bei Hitze wird körperliche Arbeit – und weniger präzise messbar auch die geistige – schwieriger, auch weil die Thermoregulation selbst Energie verbraucht, habe ich irgendwo gelesen. Das erklärt mir meine momentane Zurückhaltung bei irgendwelchen Aktivitäten.
17 Uhr. Die Zeit scheint an diesem Nachmittag still zu stehen. Nach Ansicht der Denker in den antiken Metropolen Athen und Rom, an zwei eher warmen Orten also, war große Hitze ebenso zu vermeiden wie strenge Kälte. Das rechte Maß war Trumpf, spätestens seit Aristoteles – von dem die These stammt, die Griechen lägen genau zwischen den Barbaren des kalten Nordens und denen des heißen Südens. Den Wechsel der Jahreszeiten und damit der Temperaturen feiert der Arzt Hippokrates: Dass die Asiaten als verweichlicht und feige gälten, liege außer an der dort herrschenden Despotie daran, dass dort immer das gleiche Wetter herrsche. So lässt sich Kulturchauvinismus also auch mit dem Klima begründen.
18 Uhr. Also jetzt aber ans Meer.

Oder lieber doch wieder umkehren. Zu viele Menschen. Geht grad gar nicht. Dann lieber ein bisschen durch die Stadt bummeln.
19 Uhr. Die Sonne sinkt. Um kurz nach 20 Uhr ist sie hier bereits untergegangen. Die Dämmerung ist kurz. Wenn es dunkel ist, verlagert sich das Leben auf die Straße. Bis spät in die Nacht. Beim Schlendern über den Corso strahlen die mächtigen Gebäude noch die Hitze des Tages ab. Jetzt ein Eis!